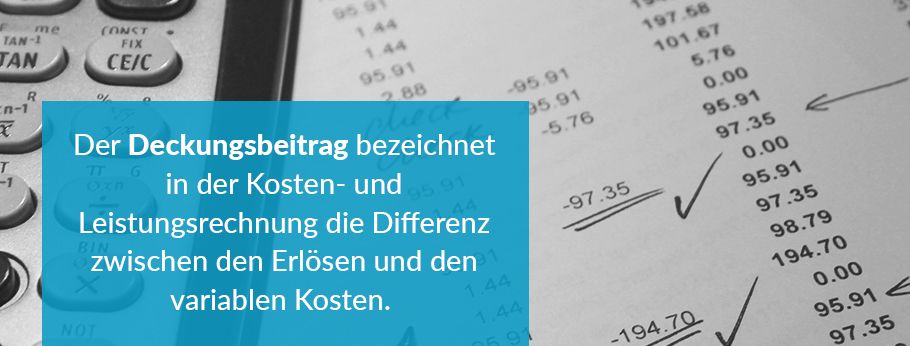Deckungsbeitrag
Grundsätzlich müssen Produkte den Erlösstrom herbeiführen, der erforderlich ist, um die Kosten zu decken und einen Gewinn zu erzielen. Sie müssen einen Deckungsbeitrag liefern. Insofern sind Produkte nicht Kostenträger, sondern Erlösbringer. Diesen Zusammenhang haben die traditionellen Kostenrechnungsverfahren nicht erkannt. Erst die Teilkostenrechnung, die den Produkten nur die durch sie unmittelbar verursachten Kosten zurechnet, hat den Weg zu einer realitätsbezogenen Unternehmensergebnisrechnung geebnet. Durch die Verbindung der Erlöse mit der Grenzplankostenrechnung entsteht die Deckungsbeitragsrechnung (DBR), die im Grundsatz wie folgt aufgebaut ist:
ERLÖSE
./. VARIABLE KOSTEN
= DECKUNGSBEITRAG
./. FIXE KOSTEN
= BETRIEBSERGEBNIS
Durch Subtraktion der Grenzkosten von den Umsatzerlösen der Produkte/Leistungen entsteht der Deckungsbeitrag des Produktes. Die Summe der Deckungsbeiträge der Produkte dient dazu, den Fixkostenblock der Unternehmung abzudecken. Durch Subtraktion der Fixkosten vom DB entsteht das Betriebsergebnis.
Die DBR ist ein typisch kurzfristiges Steuerungsinstrument. Die wesentlichen Komponenten, die der Entscheidungsträger beeinflussen kann (Erlös und Grenzkosten), sind kurzfristig beeinflussbar, während die fixen Kosten kurzfristig konstant sind. Die Zielsetzung besteht damit darin, dem Unternehmen über einen hohen Erlös- Deckungsbeitragsstrom ein entsprechendes Volumen zur Abdeckung der kurzfristig konstanten fixen Kosten zuzuführen.
Die DBR ist das für ein aktives Controlling adäquate Steuerungsinstrument:
- Mit den Grenzkosten liefert die DBR die Basis für den Soll-Ist-Vergleich, die innerbetriebliche Leistungsverrechnung und die Kalkulation der Produkte.
- Die DBR strebt die konsequente Trennung von Grenzkosten und fixen Kosten an und trägt damit der betrieblichen Kostenentstehung Rechnung. Unter konsequenter Beachtung des ostenverursachungsprinzips werden einzelnen Leistungseinheiten nur die direkt von ihnen verursachten Kosten zugerechnet.
- Die DBR berücksichtigt, dass die Gewinnschwelle erst im Laufe eines Geschäftsjahres erreicht wird und zu Beginn des Geschäftsjahres zunächst einmal ein Verlust in Höhe der fixen Kosten entsteht. Sie zeigt damit, dass einzelne Produkte keinen Gewinn bringen, sondern lediglich einen Beitrag zur Deckung der Unternehmensfixkosten leisten.
- Das Prinzip des Management by Objectives, das ein wesentliches Kriterium eines aktiven Controlling-Systems darstellt, wird durch die DBR rechnungstechnisch ermöglicht. Durch die Möglichkeit, die wesentlichen Ergebniskomponenten bereichsweise aufzuspalten und zuzurechnen, ist ein Instrumentarium geschaffen worden, das den einzelnen Bereichsleitern die Steuerung gamäß ihrer Objectives ermöglicht.
Die wesentlichen Kritikpunkte am einfachen Direct Costing lassen sich in zwei Kategorien zusammenfassen:
- Die unterstellte lineare Proportionalität von variablen Kosten und Erlösen ist unrealistisch, da z. B. auf der Kostenseite überdurchschnittlich steigende Löhne bei Überstundenfertigung oder auf der Erlösseite Preisdifferenzierung und Rabatte keinen linearen Zusammenhang zur Folge haben. Die allein relevante Einflussgröße ist die Beschäftigung, das heißt sämtliche Kosten müssen in fixe und variable hinsichtlich der Ausbringungsmenge zerlegt werden. Dabei wird zu wenig auf deren Zurechenbarkeit abgestellt; es wird übersehen, dass auch Teile der variablen Kosten Gemeinkostencharakter besitzen und nicht direkt auf die Kostenträger verrechnet werden können. Die notwendigen Prämissen des Direct Costing lassen daher eine adäquate zahlenmäßige Abbildung des Betriebsprozesses nur bedingt zu.
- Die einfache DBR geht nach einem retrograden Schema vor, das heißt sie geht vom Preis aus, und damit sind Entscheidungen bei nicht gegebenen Preisen unmöglich. Die Orientierung an Marktgrößen zeigt zwar die Kostentragfähigkeit der Produkte, es fehlt aber die exakte Berechnung von Stückkosten. Bei der Einführung neuer Produkte oder bei Sonderfertigung kann das Direct Costing daher keine Preiskalkulation liefern. Die Tatsache, dass die fixen Kosten en bloc den Leistungen des Betriebs gegenübergestellt werden, schränkt insbesondere die Erfolgsplanung und die Betriebskontrolle ein. Über die Erweiterung oder Verringerung von Kapazitäten sollte nur unter differenzierter Berücksichtigung der fixen Kosten entschieden werden. Denn oft können zumindest Teile der fixen Kosten speziellen Bezugsobjekten wie Betriebsbereichen oder Kostenstellen zugerechnet werden. Auch kann eine Erfassung der unterschiedlichen zeitlichen Abbaufähigkeit von fixen Kosten (z. B. sprungfixe Kosten) wertvolle Informationen für erforderliche Dispositionen liefern.
Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung (Fixkostendeckungsrechnung)
Bei Aufspaltung nach Produkten werden die fixen Kosten entsprechend ihrer Zurechenbarkeit auf einzelne Produkte, Produktgruppen oder auf das gesamte Produktionsprogramm aufgegliedert in Produktfixkosten, Produktgruppenfixkosten und fixe Kosten des Produktionsprogramms. Bei Differenzierung nach Abrechnungsbereichen sind die Kostenstellen, die Kostenstellenbereiche und die Unternehmung als Ganzes Bezugsbasis der Fixkostentrennung. Es erfolgt eine Eingruppierung der fixen Kosten in Stellen-, Bereichs- und Unternehmensfixkosten.
Durch spezielle Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Fertigungsstruktur und Kostenstellengliederung bei der Fixkostenaufspaltung und durch Kombination der verschiedenen Bezugsgrößen lassen sich unterschiedlich ausgeprägte Fixkostengliederungen und -zurechnungen vornehmen.
Im Hinblick auf die fünfstufige Struktur des Fixkostenblocks können folgende Fixkostenstufen unterschieden werden:
- Erzeugnisfixkosten: Kosten, die nur zugerechnet werden, wenn dieser Fixkostenblock ausschließlich durch bestimmte Erzeugnisse verursacht wird, wie z. B. Kapitaldienst für Anlagen, die nur artikelbezogen genutzt werden, oder artikelbezogene Werbeaufwendungen.
- Erzeugnisgruppenfixkosten: In diese Gruppe fallen die durch bestimmte Erzeugnisgruppen verursachten fixen Kosten wie Fertigungseinrichtungen, Promotions, Verkaufsförderungsmaßnahmen.
- Kostenstellenfixkosten: Darunter fallen z. B. spezifische Personalkosten, Kapital- und Raumkosten bestimmter Kostenstellen, die von bestimmten Kostenträgern in Anspruch genommen werden.
- Bereichsfixkosten: Diese Kosten umfassen den Rest der fixen Kosten, die einzelnen Unternehmensbereichen noch zugerechnet werden können.
- Unternehmensfixkosten: fixe Kosten, die keinem Bereich eindeutig zugerechnet werden können.
Eine derartige Differenzierung der fixen Kosten führt zu einer Erfassungshierarchie, die beliebig weit aufgegliedert werden kann. Die Bildung von Fixkostenstufen erlaubt dabei, dass fixe Kostenelemente in die Kostenträgerrechnung eingehen. Diese geschichtete Kostenträgerrechnung kann als retrograde Kalkulation zur Überprüfung der Kostentragfähigkeit bzw. Kostenverursachung oder als progressive Kalkulation zur Preisfindung eingesetzt werden.
Progressive Kalkulation
Ist der Angebotspreis eines Produktes zu ermitteln, so kann ausgehend von den variablen Stückkosten eine schrittweise Addition anteiliger fixer Kosten zur Preisfindung führen (progressive Kalkulation). Hierzu werden Erfahrungswerte aus der Nachkalkulation zur Aufteilung der fixen Kosten in Prozentwerte der variablen Stückkosten oder Deckungsbeiträge herangezogen:
VARIABLE KOSTEN
+ PRODUKTFIXKOSTEN
+ ANTEILIGE PRODUKTGRUPPENKOSTEN
(in % der variablen Kosten)
+ ANTEILIGE KOSTENSTELLENFIXKOSTEN
(in % der variablen Kosten)
+ ANTEILIGE BEREICHSFIXKOSTEN
(in % der variablen Kosten)
+ ANTEILIGE UNTERNEHMENSFIXKOSTEN
(in % der variablen Kosten)
= SELBSTKOSTEN
+ GEWINN
= ANGEBOTSPREIS
Die progressive Kalkulation mithilfe von stufenweise differenzierten Fixkostenzuschlägen ist exakter und aussagefähiger als eine einfache DBR und lässt auch Entscheidungen bei nicht gegebenen Preisen zu.
Retrograde Kalkulation
In der Regel wird die Fixkostendeckungsrechnung daher nur zur retrograden Kalkulation verwendet. Diese ermittelt rückschreitend aus der Differenz von Nettoerlös und variablen Kosten durch stufenweisen Abzug der Fixkostenschichten das Nettoergebnis der Unternehmung:
BRUTTOERLÖS DER PRODUKTART
./. ERLÖSSCHMÄLERUNGEN
= NETTOERLÖS DER PRODUKTART
./. VARIABLE KOSTEN DER PRODUKTART
= DB I (= Erzeugnisdeckungsbeitrag)
./. PRODUKTFIXKOSTEN
= DB II –> Zusammenfassung nach Produktgruppen
./. PRODUKTGRUPPENFIXKOSTEN
= DB III –> Zusammenfassung nach Kostenstellen
./. KOSTENSTELLENFIXKOSTEN
= DB IV –> Zusammefassung nach (Betriebs-, Produkt-,
./. BEREICHSFIXKOSTEN Verfahrens-) Bereichen
= DB V –> ZUsammenfassung aller Deckungsbeiträge
./. UNTERNEHMENSFIXKOSTEN
= NETTOERFOLG
In der Fixkostendeckungsrechnung werden die fixen Kosten nur soweit auf die einzelnen Bezugsgrößen bzw. Abrechnungsbereiche verrechnet wie eine verursachungsgemäße Zurechnung möglich ist. Damit wird auf die umstrittene Schlüsselung der fixen Kosten verzichtet. Die gestuften Deckungsbeiträge zeigen unverfälscht an, in welchem Maße Produktarten und Produktgruppen die Fixkostenschichten decken bzw. einen Gewinnbeitrag leisten. Daher vermag die Fixkostendeckungsrechnung bessere Einblicke in die Erfolgsstruktur des Produktonsprogramms eines Unternehmens zu vermitteln, indem Aufschlüsse über den Beitrag einzelner Produkte bzw. Produktgruppen über die Deckung der durch sie verursachten fixen Kosten hinaus zur Deckung der Unternehmensfixkosten und zur Erzielung eines Gewinnes bzw. Verlustes geliefert werden. Informationen der mehrstufigen DBR können damit zu einer höheren Qualität von Absatz-, Produktions- und Investitionsentscheidungen beitragen, da die produkt-, produktgruppen- und bereichsbezogenen Deckungsbeiträge unmittelbar erkennen lassen, welche Produkte, Produktgruppen und Bereiche absatzmäßig zu fördern bzw. in welchen Bereichen Stilllegungen oder Erweiterungsinvestitionen in Erwägung zu ziehen sind.
Gleichwohl sollten die mithilfe der Fixkostendeckungsechnung ermittelten Daten nicht ohne weitere Informationen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden, insbesondere dann nicht, wenn es um die kurzfristige Umstellung des Produktionsprogramms geht. Wird z. B. aufgrund der Tatsache, dass ein bestimmtes Produkt einen niedrigen oder negativen Deckungsbeitrag erzielt, eine Eliminierung des Produktes aus dem Programm in Betracht gezogen, so ist zu berücksichtigen, dass sich die dem Produkt zurechenbaren fixen Kosten meist nicht oder nur sehr langsam abbauen lassen (Kostenremanenz). Die im Programm verbliebenen Produkte müssen dann die Fixkosten des eliminierten Produktes mittragen. Die erhoffte Ergebnisverbesserung kann sich damit in ihr Gegenteil umkehren. Die Fixkostendeckungsrechnung ist für kurzfristige Entscheidungen also nur unter Heranziehung weiterer Informationen über die Abbaubarkeit von fixen Kosten verwendbar.
Als in dieser Hinsicht relevante Information kann die Zahlungswirksamkeit der Kosten herangezogen werden. Um neben dem Gesichtspunkt der Kostenverursachung auch dem Liquiditätsaspekt Rechnung zu tragen, kann zusätzlich zur Strukturierung des Fixkostenklocks nach der Zurechenbarkeit dessen Aufspaltung nach der Ausgabewirksamkeit seiner Bestandteile erfolgen. Besonders bei angespannter Liquiditätslage ist die Frage nach der liquiditätsorientierten Preisuntergrenze zu beantworten, weil dann nicht den Kosten, sondern den Zahlungsvorgängen existentielle Bedeutung zukommt. Eine etappenweise Ermittlung liquiditätsorientierter Deckungsbeiträge versetzt jedoch den Betrieb in die Lage, für jedes Produkt, jede Produktgruppe und jeden Betriebsbereich die absolute Untergrenze der Deckung ausgabewirksamer Kosten durch die jeweiligen Produktpreise zu erkennen. In der liquiditätsorientierten Fixkostendeckungsrechnung darf jedoch keinesfalls ein Ersatz für die Finanzplanung gesehen werden, allenfalls eine Ergänzung.